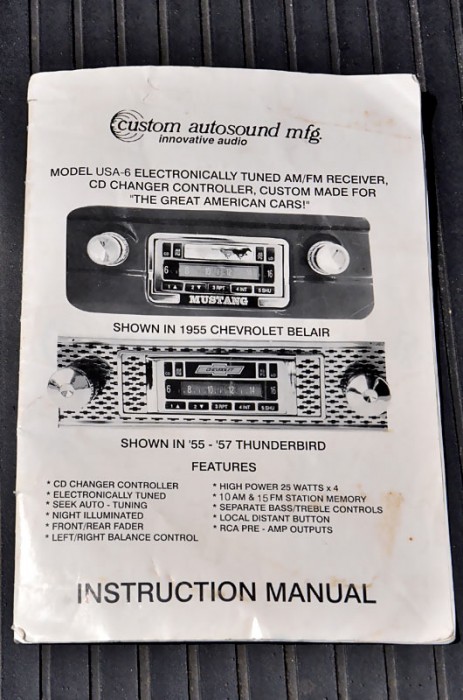22 Okt Corvette C1 – The American Dream
Die frühe Chevy Corvette, Codename C1, ist eine Ikone der amerikanischen Autowelt. Das Rezept: Sündhaft sinnliche Formen wie bei der Monroe treffen auf opulent überbordende Chromzier wie bei einer Wurlitzer-Musikbox. Man muss schon höllisch aufpassen, dieser Schönheit nicht blind zu verfallen
Eine Kaufberatung? Wir hätten auch mehrere über die Corvette C1 schreiben können, denn sie wurde im Lauf ihrer Bauzeit von 1953 bis 1962 so intensiv modellgepflegt, dass man sich schon entscheiden muss, für welche Untervariante diese eigentlich gelten soll. Die wirkliche Ur-Corvette von 1953 wirkte noch ein wenig pummelig, das Design wurde im Laufe der ersten Jahre immer eleganter und dank der Doppelscheinwerfer ab 1958 auch sportlicher. Unser Fotomodell, ein 1961er-Modell, ist für viele das Schönste, denn es hat noch die alte Front und Seitenlinie mit den herrlichen farblich abgesetzten Mulden („coves“). Gleichzeitig nimmt sie aber schon das gefällige „duck tail“ mit den vier Rückleuchten vorweg, das ab dem Modell C2 „Sting Ray“ zum Markenzeichen der Vette wurde. Deshalb gilt die Kaufberatung vor allem für diesen letzten Baujahrszeitraum.
Apropos Baujahr: In einer früheren Kaufberatung hatten wir den Ur-Enkel der Corvette C1, nämlich das Coke-Bottle-Modell C3, unter die Lupe genommen. Da ist es spannend, nun zu sehen, wieviel Genmaterial aus dem Urmodell stammt. Und dabei muss man feststellen, dass es außer einigen Details wie der Kunststoffkarosserie und einem V8 unter der Haube erstaunlich wenig ist.
Die C3 wirkt optisch so ungleich viel machohafter und auch selbstdarstellerischer. Sie ist ein Auto, neben dem alle zehnjährigen Jungs stehen bleiben, sich in die Rippen boxen und sagen: „Guck mal, boah geil, ey …“ An der vergleichsweise dezenten Corvette C1 würden sie dagegen vermutlich relativ unbeeindruckt vorbeigehen. Relativ, denn ein bisschen auffällig ist sie schließlich auch. Allerdings passt sie anstatt zu Bodybuildern und Wrestling-Fans mit wilder Mähne eher zu smarten jungen Männern aus begütertem Hause, die in der Vette – bekleidet mit weißen Leinen-Turnschuhen und einem Lacoste-Shirt – zu ihrer Segelyacht fahren.
So viel zu den Äußerlichkeiten. Fährt man mit einer frühen Corvette, so bleibt von aller Eleganz plötzlich nur noch das zierliche Lenkrad mit gewaltigem Durchmesser, mit dem sich der Wagen erstaunlich leicht dirigieren lässt. Erstaunlich deshalb, weil die frühen Vettes keine Servolenkung besaßen. Alles andere, wirklich alles, wirkt unglaublich schwer. Daran ändert auch der Glasfaser-Body wenig, den die Vette aus Gründen der Gewichtseinsparung verpasst bekam. Er ruht nämlich auf einem Chassis-Rahmen, der aussieht, als hätte man ihn aus einem Segment der Golden Gate-Bridge herausgetrennt. Und die hält seit Jahrzehnten täglich hunderte Trucks aus.
Apropos Trucks: Schon der „Blue-flame“-Sechszylinder-Motor der Ur-Ur-Corvette war ursprünglich einem Lastwagen zugedacht, und das kann bei den diversen Achtzylindern, die ab 1956 ausschließlich verbaut wurden, nicht anders gewesen sein. Drehfreude wurde diesen Eisenklumpen nicht ins Stammbuch geschrieben, ein üppiges Drehmoment dagegen schon. Und so zieht auch der 4,7-Liter in unserem Fotomodell von der Leerlaufdrehzahl an satt durch wie Bud Spencer in „Vier Fäuste für ein Halleluja“.
Erfreulicherweise wurde „unsere“ Vette aus dem Bestand des norddeutschen Klassik-Händlers Steenbuck seinerzeit nicht mit dem häufig gewählten Zweigang-Powerglide-Automatikgetriebe oder der Dreigang-Handschaltung, sondern mit einem manuellen Vierganggetriebe geordert, so dass die Power ohne jeden Wandlerschlupf direkt an die Hinterräder gelangt. Auch die Schaltbox scheint aus einem Lkw zu stammen. Beim Betätigen des kurzen Shifters hat man den Eindruck, Zahnräder vom Mühlrad-Format ineinander zu zwingen. Dazu passt die schwergängige Kupplung, die für ordentlichen Waden-Bizeps sorgt.
Nein, ein typisches Frauen-Auto ist die Vette gewiss nicht, ein Sportwagen nach europäischem Verständnis ebenso wenig, denn auch kurvige Landstraßen sind nicht ihr Metier. Vor allem dann nicht, wenn rundum die serienmäßigen Trommelbremsen verbaut gewesen wären, doch unser Referenzfahrzeug wurde irgendwann in seinem Vorleben schon an der Vorderachse mit innenbelüfteten Scheibenbremsen ausgestattet, die es eigentlich erst ab dem Modell C3 gab. Einen beherzten Zutritt verlangen auch sie, denn einen Bremskraftverstärker sucht man vergeblich. Fahrbahnunebenheiten pariert dafür Ihr Sitzfleisch, denn die Polster der mit herrlich schimmerndem PVC-Bezug bespannten Sitze sind dünn, weshalb Sie das Gefühl haben, direkt auf der Hinterachse zu sitzen. Der sind sie auch tatsächlich wesentlich näher als der Vorderachse, die meilenweit vor ihnen angebracht zu sein scheint. Denn so klein die Corvette für amerikanische Verhältnisse auch sein mag, von drinnen scheint sich die Motorhaube endlos nach vorn zu erstrecken.
Ein Schnäppchen war die Corvette übrigens weder damals noch heute. Für die rund 4.000,- Dollar, die eine neue C1 zum Schluss kostete, bekam man alternativ auch einen rassigen Jaguar XK 150 oder einen 356er-Porsche und noch etwas Rückgeld. Dafür hinterlässt die C1-Vette, die es übrigens ausschließlich als Cabriolet gab (ab 1956 wurde optional ein Hardtop angeboten) einen ziemlich unamerikanischen Qualitätseindruck. Denn wer US-Cars kennt, ist normalerweise eine außerordentlich reichhaltige Komfortausstattung und viel „Bling-bling“, dafür aber oft auch eine Menge „tacky plastic“ gewöhnt. Nichts davon findet sich an der C1-Corvette. Hier wirkt jedes Detail als sei es aus dem Vollen gefräst, vom Handbremshebel bis zum Betätigungsknopf für die Verdeck-Abdeckung, die einen beherzten Druck verlangt, um das Schloss zu entriegeln. Aus diesem Grunde – und das ist für US-Cars jener Zeit ebenfalls ziemlich ungewöhnlich – funktionieren bei unserem Referenzfahrzeug auch sämtliche Instrumente, vom Drehzahlmesser, der über eine solide Welle von der Lichtmaschine angetrieben wird über die Zeituhr bis zum Öldruck-Manometer. Nach alldem kommen wir zu der Überzeugung, dass sämtliche C1-Vetten, die nicht bis heute überlebt haben, eigentlich nur einen Unfalltod gestorben sein können. Andere Formen des „Verendens“ sind kaum vorstellbar.
Wer also ein US-Car mit einer Verarbeitungsqualität sucht, die sogar zeitgenössische Mercedes-Güte locker in den Schatten stellt und wer dafür bereit ist, sich mit schwerfälliger Nutzfahrzeug-Technik auseinanderzusetzen und auch einen entsprechenden Kraftstoffverbrauch akzeptiert, der bekommt ein herrlich nostalgisches Cabrio, das zumindest als Achtzylinder mit reichlich „Dampf“ unter der Haube aufwartet und allen Design-Attributen, die die „Fifties“ bereit hielten. Dazu fehlen dann nur noch die Leinen-Turnschuhe, das klassische Polohemd, die Segelyacht und eine kesse Petticoat-Blondine auf dem Beifahrersitz. Bis auf Letztere kann man sich alles kaufen, und das sollte man auch tun. In der beschriebenen Reihenfolge. Fangen Sie also schon mal mit dem Auto an.
Die Chevrolet Corvette C1 im Detail: Karosserie, Unterboden
Front, Motorraum, Vorderkotflügel
Da die Corvette C1 eine vollständige Kunststoffkarosserie besitzt, sind Reparaturen daran eher ein Fall für den Bootsbauer als für den Blechner. Der bekommt nur dann etwas zu tun, wenn der wirklich außerordentlich solide Stahlrahmen mit Kreuzstreben ausnahmsweise ein paar Jahre im Salzwasser geparkt haben sollte – oder wenn er aufgrund eines Unfallschadens verzogen sein sollte. Bei den Preisen, die frühe Vetten in gutem Zustand mittlerweile erzielen, kann sich allerdings auch eine aufwändigere Unfallschaden-Instandsetzung lohnen. Unter 40.000,- Euro sind C1-Vetten ab Baujahr 1954 kaum in vernünftiger Verfassung zu bekommen, Spitzenexemplare kosten mehr als das Doppelte – und allein für die superseltenen 53er-Modelle können Sie diese Preisangaben gleich noch mal verdoppeln. Da lohnt es sich, detailliert nach Pfusch zu suchen, insbesondere bevor Sie sich ein solches Auto selbst über den großen Teich holen.
Frontmaske, Vorderkotflügel
Der größte Teil der Kunststoffkarosserie ist zu einem Stück zusammenlaminiert, was Unfallreparaturen naturgemäß nicht eben erleichtert. Rissbildung durch Materialversprödung oder Vibrationen ist häufiger zu beobachten. Achten Sie auf die vorderen Endspitzen des Rahmens, denn die können durchaus rosten.
Türen
Bei den langen, schweren Türen sind die Scharniere und die Spaltmaße zur Karosserie sowie die Gummidichtungen an den Fensterschächten zu checken. Zwar besteht die Tür selbst auch aus GFK, aber die metallenen Verstärkungen können rosten. Ist der Schließmechanismus leichtgängig?
Bodenwannen, Rahmenkonstruktion
Ein umfassender Check der Bodenwannen erübrigt sich, da auch sie aus GFK bestehen. Allerdings sollte der Trägerstruktur des Rahmens Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn die kann durch Rost im Laufe der Jahrzehnte doch strukturell geschwächt sein. Sehen Sie auch genau auf die Karosserie-Aufnahmepunkte.

Als wäre sie ein Teil der Golden-Gate-Bridge gewesen: Die Rahmen-Trägerkonstruktion ist wie für die Ewigkeit gemacht. Wenn es Rost gibt, dann gelegentlich an den Längsträgern, aber auch sie sind außerordentlich solide
Cabrioverdeck
Alle C1-Corvetten sind grundsätzlich Cabrios gewesen, auf Wunsch war ab 1956 ein Hardtop lieferbar. Überprüfen Sie den Zustand des Verdecks und hier insbesondere der Scheibe. Sie war bei frühen Modellen eingenäht, bei späteren eingeschweißt.
Heckbereich
Wie vorne ist die Karosserie auch hinten auf Rissbildung und Unfallschäden hin zu untersuchen, wobei die sonst häufig sinnvolle Schichtdickeprüfung mit einem Magneten hier natürlich nicht möglich ist. Unsaubere Konturen und wellige Flächen können ein Hinweis auf üppigere Spachtelarbeiten sein. Auch die hinteren Aufnahmepunkte, wo die Karosserie mit dem Rahmen verbunden ist, können rahmenseitig von Korrosion gezeichnet sein – nicht oft, aber es kommt vor.
Motor und Peripherie
Motorspezifisches
Die Corvette C1 wurde mit einer Vielzahl verschiedener Motorisierungen ausgeliefert, zunächst mit einem 3,8-Liter-V6, der 150 PS leistete, ab 1955 war zuerst ein 4,3-Liter-V8 optional erhältlich, der 195 PS leistete, ab 1956 gab es ausschließlich Smallblock-Achtzylindermotoren mit bis zu 5,4 l Hubraum und in einer Einspritzerversion maximal 360 PS. Will man es unkompliziert haben, sollte man von den Einspritzmotoren die Finger lassen. Die Einspritztechnik gilt als kapriziös, die Motoren als überhitzungsgefährdet.
Getriebe, Kraftübertragung
Getriebe
Die Corvette C1 gab es zu Beginn wahlweise mit einer Zweigang-Powerglide-Automatik sowie mit Dreigang- oder Viergang-Handschaltung. Alle Schaltboxen sind unproblematisch in puncto Haltbarkeit, allerdings gehen im Automatikgetriebe wertvolle Pferdestärken im Wandlerschlupf verloren. Häufiger sind kleine Undichtigkeiten – vor allem am Kardanwellenausgang und an der Getriebehauptwelle zu beobachten. Solange sich nicht ständig Ölpfützen unterm Auto bilden, sollte man es bei einer regelmäßigen Ölstandskontrolle bewenden lassen.
Fahrwerk, Lenkung, Bremsen
Fahrwerk, Federung
Das Fahrwerk der Corvette C1 ist nicht das Glanzkapitel des ansonsten bestechend qualitätsvollen Autos. Nicht, dass hier viele Defekte auftreten würden – regelmäßige Schmierdienste vorausgesetzt sind die vorderen Querlenker robust. Echte Schwachpunkte sind die teigige Lenkung sowie der Federungskomfort mit der blattgefederten hinteren Starr-achse, und auch die serienmäßigen Trommelbremsen vorn und hinten ermuntern nicht zur längeren schnellen Kurvenfahrt auf engen Landstraßen.
Lenkgetriebe, Umlenkhebel, Spurstangen
Bei höherer Laufleistung nervt mitunter Spiel in der gesamten Lenkmechanik, zum Beispiel bei den (abzuschmierenden) Spurstangenköpfen, aber auch beim Lenkgetriebe und vor allem beim verschleißanfälligen Umlenkhebel. Zum Glück sind Verschleißteile mit Ausnahme des Lenkgetriebes problemlos lieferbar und sie sind sogar überraschend preiswert.
Bremsanlage
Vier Trommelbremsen sind in den 1950er- und 60er-Jahren zwar allgemein amerikanischer Standard gewesen, aber für einen angeblichen Sportwagen kein besonderes Aushängeschild. Deshalb wurden, wie bei unserem Referenzauto, häufig Umrüstungen auf Scheibenbremsen vorgenommen, was sicherlich eine sinnvolle Maßnahme ist.
Innenraum, Elektrik
Innenausstattung
Wie praktisch alles an den frühen Vettes ist auch das Interieur strapazierfähig und solide, lediglich die PVC-Bezugsstoffe können rissig sein und das Armaturenbrett ausgeblichen. Ansonsten gilt bei der nicht gerade opulent ausgestatten C1-Vette, dass nicht kaputt gehen kann, was gar nicht da ist. Ein Check aller Instrumente sowie der Elektrik (Funktionsfähigkeit von Licht und Wischern) sollte trotzdem vor- genommen werden.
Technische Daten |
|
| Chevrolet Corvette C1 (Referenzfahrzeug Bj. 1961) | |
| Motor: | V8-Motor |
| Hubraum: | 4,7 l |
| Leistung: | 234 PS |
| Getriebe: | 4-Gang-Handschaltung |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Länge / Breite / Höhe: | 4.450/1.770/1.260 mm |
| Gewicht: | ca. 1.305 kg |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | k. A. |
| Top-Speed: | k. A. |
| Neupreis 1961: | ca. 4.000,- USD |
| Anbieter: | Steenbuck-Automobiles, Gödenstorf-Lübberstedt |
Fotos: Martin Henze